Ich möchte, dass Du…!
Diesmal geht es darum, wie Menschen sich selbst und andere stabil unglücklich halten und hilfreiche Veränderungen verhindern.
Menschen befinden sich im Grunde unkompliziert und laufend in Veränderungsprozessen. Man nennt das üblicherweise Entwicklung. Das ist so, weil Menschen selbstorganisierte Prozesse sind. Selbstorganisation spielt mit Veränderung auf der Grundlage von Stabilität und Wandel. Zunächst muss jedes selbstorganisierte System vieles stabil halten. Man wechselt nicht täglich Wohnung, Arbeit, Partner und Ernährungsgewohnheiten.
Aber Stabilität ist etwas anders als Stagnation.
Stagnation bedeutet, dass man auch dann noch das Selbe macht, wenn es sich als untauglich erwiesen hat. Das liegt daran, dass Stagnation zwei Herren (in der Psyche) dient. Einer Seite, die am Bestehenden festhalten möchte und eine, die sich verändern will, weil sie merkt, dass etwas nicht stimmt. Die erstere ist meist latent, unbewusst, verdeckt. Die zweite kommt im Verändern nicht so recht voran. Diese gegenläufigen Prozesse beeinträchtigen und zerstören schlussendlich die seelische Autonomie, also die Fähigkeit Stabilität und Wechsel zu gestalten. Wie kommt es, dass Menschen leiden oder andere leiden lassen und nichts verändern oder die Versuche scheitern? Wie gibt man seine Autonomie auf? Wenn man das nicht versteht, baut jede Veränderungstheorie auf ungeklärtem Grund.
Wie gibt man seine Autonomie auf?
Autonom ist jemand, der seine Abhängigkeiten selbst bestimmt. Diese paradoxe Formulierung – frei nach N. Luhmann – bringt auf den Punkt, dass jeder Mensch die Wahl hat, worauf er versucht Einfluss zu nehmen und was er als Widerfährnis erlebt. Anstreben und Loslassen – zwischen diesen Polen wählt ein autonomer Mensch. Damit hat man die konzeptionelle Grundlage zu bestimmen, wie man seine Autonomie signifikant einschränkt. Das geschieht dadurch, dass man etwas unbedingt haben oder unbedingt verhindern will. In beiden Fällen gibt man seine Freiheit auf. Man bestimmt seine Abhängigkeit nicht mehr bewusst selbst, sondern man wird durch innere Fixierungen („Das muss so geschehen!“) oder eine innere Abwehr („Das darf nicht geschehen!“) bestimmt.
Für den Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen ist der einfachste Satz, um zum Ausdruck zu bringen, was man tun muss, um seine Glücksfähigkeit aufzugeben: „Ich möchte, dass Du…“! Alternativ kann man auch „Solange Du, werde ich nicht…!“ oder „Erst wenn Du, werde ich …!“ versuchen. Jeder dieser Sätze bringt zum Ausdruck, dass der Sprecher sein Wohlbefinden von bestimmten Verhaltensweisen eines anderen abhängig macht. Man gibt anderen Macht über sich und weil das unangenehm ist, versucht man das umzudrehen und über Belohnung und Bestrafung andere zum erwünschten Verhalten zu bringen. Warum tun Menschen so etwas? Sie tun das, weil sie sonst in Gefühlszustände kommen würden, die sie nicht haben wollen:
- Weil man zu spüren droht, wie gering die eigene Selbstachtung ist, soll der andere einem Wertschätzung entgegen bringen.
- Weil man zu spüren droht, wie hoch die Angst vor Ablehnung ist, soll der andere einem das Gefühl geben, wichtig zu sein.
- Weil man zu spüren droht, wie groß die Angst vor Verlassen-Werden ist, soll der andere seine Unabhängigkeitsbestrebungen aufgeben und nur für einen selbst da sein.
- Weil man zu spüren droht, wie unsicher man sich fühlt, soll der andere kritische Nachfragen unterlassen.
- Weil man zu spüren droht, wie schuldig man sich fühlt, soll der andere keine Vorwürfe machen.
- Weil man zu spüren droht, wie sehr man sich schämt, soll der andere das Thema nicht ansprechen.
- Weil man zu spüren droht, wie unfrei man sich fühlt, soll der andere einem die Erlaubnis geben.
- Weil man zu spüren droht, wie leer und hochstaplerisch man sich innerlich fühlt, soll der andere für ausreichend Bewunderung sorgen.
Das mögen der Beispiele genug sein. Es gäbe Tausende mehr. Das Prinzip ist immer gleich: Weil man etwas in sich nicht spüren will (siehe auch Teil 2 der Serie), versucht man in der Umwelt Bedingungen zu schaffen, die sicher stellen sollen, dass diese Gefühle nicht aktiviert werden.
„Bitte benehmt Euch so, dass ich mich nicht schlecht fühle!
oder auch gern andersherum
„Bitte benehmt Euch so, dass ich mich gut fühle!“
Diese Kausalität zwischen dem Verhalten anderer und dem eigenen Seelenzustand ist natürlich eine Konstruktion. Niemand kann einem anderen Gefühle „machen“. Jedes Verhalten von Person A, ist ein Reiz für Person B – die psychische Reaktion aber bleibt prinzipiell immer eine freie Entscheidung von Person B. Diese innere Freiheit – reagiere ich auf Kritik mit Humor, Neugier, Angst oder Gekränktsein – ist bei vielen Menschen eingeschränkt durch die (Reaktions- und Erlebnis-)Muster, die sie sich erworben haben. Dieser „Erwerb“ findet fast überall statt. Die Suggestion, dass etwa Kinder den Eltern „Gefühle machen“ können, ist leider gängiges Erziehungsmittel: „Wenn Du das tust, wird der Papa/die Mama aber traurig/ängstlich/wütend etc.!“ Die Eltern suggerieren dem Kind, es hätte Macht über die Gefühle der Erwachsenen. So beginnt für viele Kinder die Karriere derer sehr früh, die annehmen, man könne mit seinem Verhalten oder Sein andere glücklich oder unglücklich machen. Diese unsinnige Annahme einer Kausalität zwischen Verhalten des einen und Erleben des anderen führt zur Stagnation bzw. verhindert ein freies, sich auf wechselnde Bedingungen einstellendes menschliches Dasein.
Es ist offensichtlich, dass dieses Prinzip einen hohen Vervielfältigungswert hat. Wer als Eltern seine Kinder erzieht und trainiert, um sich vor eigener Minderwertigkeit, eigenen Unsicherheiten, eigenen Dominanzängsten, eigener Ohnmacht, eigener Nähe- oder Distanzangst und eigenen Schamgefühlen zu schützen, der wird Kinder bekommen, die das ihrerseits als Mittel ungünstiger Selbstregulation einsetzen. Warum ist das ungünstig? Der große Nachteil solch seelischer Verklammerungen ist, dass sie eine Notwendigkeit zur Kontrolle und Manipulation anderer Menschen mit sich bringen. Es erschließt sich unmittelbar, welches Konfliktpotential und Leid sich daraus konsequent entwickelt.
So kommt es zu stagnativen Beziehungen
Zunächst versuchen Menschen, die etwas in sich nicht spüren wollen, naheliegenderweise sich mit solchen Menschen zu umgeben, die für diese unerwünschten Empfindungen keine „Reizauslöser“ sind. Das geht an leichtesten, wenn man daraus einen wechselseitigen Deal in Form einer Symbiose macht: „Ich benehme mich so, dass Du Deine Ängste kaum spüren musst, dafür benimmst Du Dich so, dass ich meine Ängste nicht spüren muss!“ So schützt etwa der eine den anderen vor Unsicherheit, indem er selbst (nur) sicher und stark ist, und der andere bewundert den einen, um ihm das Gefühl zu geben, toll zu sein und damit seine Minderwertigkeitsgefühle nicht zu spüren. J.Willi nannte das bei Paaren „Kollusionsbeziehung“, Freud allgemeiner „Abwehrbündnis“. Das ist erstmal praktisch. Ich habe die Chefin, die mich lobt, den Mitarbeiter, der nicht kritisiert, die Partnerin/den Partner, mit der/dem ich mich schmücken kann, die Kollegin, der ich mich überlegen fühle, usw. usf.
Eher unpraktisch ist dabei, dass sich beide Seiten nicht mehr verändern können (und dürfen), da dann der Deal nicht mehr funktioniert und Sanktionen drohen. Gleichzeitig wird aber das, was ursprünglich so attraktiv war, langweilig. Und in Summe sind solche Beziehungen einfach anstrengend, weil man ja immer damit beschäftigt ist, dieses Schlüssel-Schloss-Geschehen aufrechtzuerhalten. Die Anstrengung äußert sich besonders auch in Konflikten, die bei drohendem oder geschehenem Bruch des Deals ins Leben treten:
- „Früher hat Dir das doch auch gefallen, wenn ich Dir das abgenommen habe“
- „Jetzt willst Du plötzlich Gefühle, statt des schönen Hauses!“
- „Verstehe gar nicht, warum Sie nun immer was auszusetzen haben. Verlassen Sie sich einfach auf mich!“
- „Machen Sie einfach, was ich sage, dann ist alles gut!“
- „Ich kann Dir nicht mehr vertrauen, weil Du mir nicht alles sagst!“
- „Warum bin ich eingebildet? Zu Beginn Ihrer Tätigkeit fanden Sie mich inspirierend!“
So greifen Vorwürfe, Enttäuschungen, Verbitterung, Rückzug, Nebeneinander, Unverständnis, Trennungen, Kündigungen, Dauerkonflikte mehr und mehr um sich. Alles das nur, um die ursprünglicheren schlechten Gefühle aus dem Erleben zu verbannen. So wechseln die Beziehungsmuster wie das innere Erleben der Beteiligten von primären zu sekundären Prozessen. Ist erstmal „Sekundäres“ im Spiel, herrscht die Stagnation und ein Ringen gegen das, was nicht sein soll. Bedürfnisse sind in solchen Beziehungen nicht mehr im Spiel.
Was tun?
Wie meistens ist es leicht gesagt und schwer gemacht, worin der Ausweg besteht.
Man kann aufhören, andere Menschen für seine Empfindungen verantwortlich zu machen.
Das geht. Wer andere nicht mehr dafür verantwortlich macht, eigene unverarbeitete Ängste, Minderwertigkeiten, Schmerzen, Trauer, Schuld und Schamgefühle auszulösen, wird frei. Er muss weder sich noch andere verbessern oder glücklich „machen„. Es reicht dann glücklich zu sein. Nur (!) – wenn man das tut, ist man ziemlich unerbittlich auf sich selbst zurückgeworfen. Dann spürt man die eigenen Begrenzungen, seine Wunden und Narben. Wer damit seinen Frieden macht und findet, wird innerlich heil. Dann ist man nicht mehr auf die „Glücklichmachung“ durch andere angewiesen und glaubt auch nicht mehr, andere „glücklich“ machen zu können. Glück findet jeder nur in sich – nicht im Äußeren. Dieser Satz legt große Missverständnisse nahe, nämlich dass man dann allein zurechtkommen muss, dass die Lebensumstände und andere Menschen keine Bedeutung mehr hätten, man den Frieden mit sich selbst allein finden könnte oder man anderen nichts Gutes mehr tun wollen würde u.a.m.
In dem Fall verwechselt man aber die Verantwortung für sich selbst (= Autonomie) mit Egozentrik (= Autarkie)
Mehr zu dem Zusammenhang findet sich unter dem Begriff „Leitprozess Selbstverantwortung“ in unserem Beratungstheorie-Portal hier.
Darum ist es ganz besonders wichtig, den Stellenwert und die Funktion anderer Menschen für die eigenen seelischen Prozesse und für die Heilung alter Wunden zu verstehen. Im vierten Teil dieser Serie wird es folglich darum gehen, dass wir Menschen uns ohne Bindung und Verbindung zu anderen, nicht verändern können. „Ohne Kontakt ist alles nichts!“ wird die Überschrift sein.
—
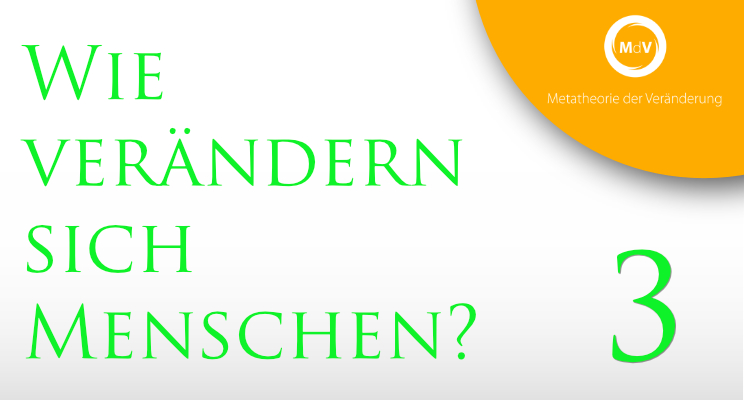
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.