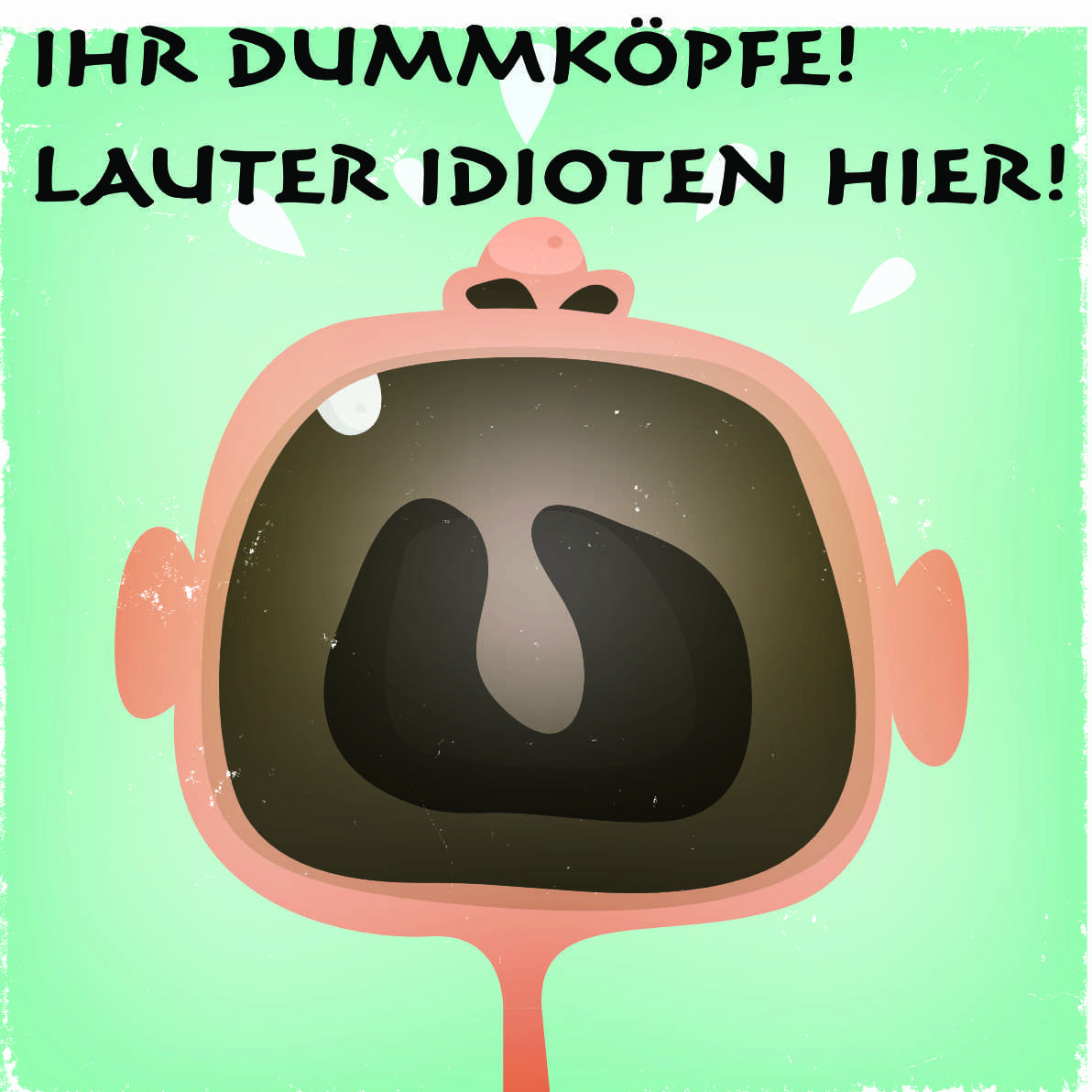
Klaus Eidenschink
Empörung
Empörung schadet. Fast ausnahmslos und vorrangig dem, der empört ist. Empörung ist ein sogenanntes sekundäres Gefühl. Wie das Adjektiv schon zu erkennen gibt, muss man primäre und sekundäre Gefühle unterscheiden. Sekundär meint, dass man mit Hilfe von dem einem Gefühl (sekundär) ein anderes (primäres) Gefühl zu umgehen versucht. Also z.B. ist man traurig, will das nichts sein und wird stattdessen zornig. Oder man ist verletzt, will das nicht sein und man reagiert mit Verachtung.
Diese Art der Verarbeitung von Gefühlen ist ungünstig, weil das psychische System in seiner Selbststeuerung so destabilisiert und fragiler wird. Zudem erzeugen sekundäre Gefühle in Beziehungen Effekte wie Konflikte, Gegenaggression, Rückzug, Kontaktabbruch, Lagerbildung und falsche Anpassung. Das nehme ich mal zum Anlass ein paar Sätze über die Psychodynamik der Empörung zu schreiben.
Empörung setzt zweierlei voraus: Erstens muss der oder die Betreffende eine klare Vorstellung davon haben, wie etwas sein soll oder nicht sein darf. Zweitens muss es jemand oder etwas geben, das gegen diese Erwartung verstößt. Das müssen nicht zwangsläufig Personen sein, sondern man kann sich auch über Institutionen, empfundene Ungerechtigkeiten, Entscheidungen, Schicksalsschläge bis hin zu Gegenständen, an denen man sich gestoßen hat, empören. Je mehr sich ein „Verursacher“ der Abweichung identifizieren lässt, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Empörung nicht nur empfunden wird, sondern auch Ausdruck findet.
Die Lieblingsform, in der Empörung sich äußert, ist Rechtschaffenheit und Selbsteingenommenheit. Diese Form ist direkte Folge der innerpsychischen Funktion, der Empörtsein dient: Selbststabilisierung! Um empört sein zu können, muss ich mich mit einem (Soll-)Wert identifizieren. Ich BIN der Wert. Wird der Wert nun verletzt, mißachtet, mit Alternativen versehen, dann werde ICH verletzt, mißachtet und verunsichert. Andere Menschen oder Umstände geben zu erkennen: Es könnte auch anders sein! Man kann anders handeln, anders denken und die Welt dreht sich nicht um mich. Die primäre Folge ist daher mehr oder weniger zwangsläufig: Kränkung. Nun gibt niemand gerne zu, dass er gekränkt ist. Da kommt die Empörung gerade recht. Denn sie erhebt einen in die Position dessen, der den besseren Wert, den intelligenteren Durchblick, das berechtigtere Anliegen, das zu bevorzugenden Ziel oder die angemessenere Not hat. Aus Kränkung wird Überheblichkeit und Abwertung von anderen und deren Standpunkten.
Der Startpunkt dieser selbstschädlichen Entwicklung ist die Identifikation mit vermeintlich richtigen und alternativlosen Werten und Ansichten. Man verwechselt sich mit Meinungen, in dem Fall mit den eigenen. Da aber Denken nie zu alternativlosen Endpunkten kommt, setzt jeder, der sich mit seinen Ansichten identifiziert auf das schwächste Pferd im Stall. Man findet in sich keinen Halt mehr in einer Welt, die zu jeder Meinung eine Gegenmeinung bereit hält.
Wer sich empört, offenbart damit innere Fragilität. Andernfalls wäre man kräftig und eindeutig, aber nicht überheblich und erregt. Man wäre dann schlicht anderer Meinung.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.